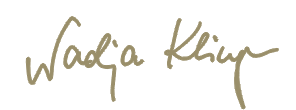Der Tagesspiegel, Juli 2010
Sie sprechen von Welt und meinen den Pott. In Elli Altegoers Tante-Emma-Laden finden die Kunden ein Ruhrgebiet, wie es früher mal war. Und zeigen nebenbei, wie sie funktionieren könnte, die neue Minderheitsregierung im großen Nordrhein-Westfalen: miteinander reden.
Wo die Farnstraße die Königsallee kreuzt, wächst ein Gebüsch. Dahinter fällt die Wiese in eine Senke, unten hockt Elli Altegoers kleiner Laden. In Kisten vorm Eingang dösen Obst und Gemüse. Die Reklametafel im Schaufenster preist ein dunkles obergäriges Bier rheinischer Brauart. Das Bier gibt's nicht mehr. Die Brauerei hat es umbenannt und an den Zutaten gebastelt, damit es, so die aktuelle Werbung, „in neuem Glanz erstrahlt“.
Elli glänzt seit Jahrzehnten mit denselben Zutaten. Sie packt die Menschen beim Vornamen an. Sie merkt sich, was andere aufs Brot haben wollen. Sie verschenkt ihr Herz. Armin Rohde sagt: „Ich weiß nicht, was werden soll, wenn Elli mal nicht mehr da ist.“ Vor Weihnachten hat er versprochen, ein leuchtendes Schild an die Straße zu stellen, das den Weg hinters Gebüsch zum Laden weist. Rohde ist Schauspieler. Gelegentlich gibt er Interviews. Spricht, wenn's irgendwie passt, von Elli. Nennt sie „unser Zentralgestirn“, erklärt sie quasi für unsterblich.
Ellis Lachen ist heiser von den Zigaretten, die sie im Leben inhaliert hat. Frühmorgens, wenn Bochum noch schläft, verknotet sie ihr weißes Haar im Nacken. Dann manövriert sie übern Großmarkt einen Einkaufswagen, der so riesig ist, dass sie sich drauf langmachen könnte. Sie packt ihn voll, reißt ihn mit aller Kraft aus der Spur, um Regale zu umkurven. Elli ist klein, nahezu fragil, aber tapfer. Wenn sie im weißen ärmellosen Kittel und Bermudahosen in den Kühlräumen Waren einsammelt, beißt sich der Frost die Zähne an ihr aus. Sie ist seit 1939 auf der Welt. Hilft ihr jemand, eine Flaschenkiste zu tragen, sagt sie: „Ich fühle mich wie 50.“ Die Kunden hören das gern. Es ist unrealistisch.
So wie Ellis Laden. Die Preise der Lebensmittel, Zeitungen, Schreib- und Haushaltswaren werden von Supermärkten weit unterboten. Kaum jemand wagt hier wöchentliche Großeinkäufe. Man kauft ihr zwei, drei Produkte ab, damit Geld in die Kasse kommt. Man trinkt Kaffee für 65 Cent und redet. Man kennt sich und vergisst einander nicht. Allen voran Elli. „Sie ist die Symbolfigur des Ruhrgebiets“, sagt Armin Rohde. Er müsste sagen: Bei Elli spielen wir Ruhrgebiet. Täuschen den Pott vor, wie er früher einmal war. Ins Spiel passt, dass mittlerweile Juli ist und Rohde, der fast jeden Tag kommt, das versprochene Schild immer noch nicht mitgebracht hat. Vielleicht ist es doch besser, den Laden hinterm Gebüsch im Bochumer Stadtteil Ehrenfeld vor der Realität zu verstecken.
Einst war der Ruhrpott Kohle und Eisenerz. Zechen, Hochöfen, Stahlwerke, Bergarbeitersiedlungen standen unterm Himmel, den Kanzlerkandidat Willy Brandt 1961 wieder blau zu machen versprach. In einem halben Jahrhundert wurde ein Wirtschaftswunder fabriziert und vorgeführt, dass Wunder vergehen. Ende der 1950er Jahre starb die Kohleindustrie, seit den 70ern ging die Stahlindustrie zugrunde. Staub und Atemwegserkrankungen verschwanden. Es verschwanden Lebensweisen und Tradition.
Heute ist der Pott Industriekultur und das idyllische Ruhrtal. Zechen sind Museen, Kreativzentren, Schwimmbäder, Eisbahnen und Trainingsorte des Deutschen Alpenvereins. Um das tägliche Leben in den Ruhrgebietsmetropolen kümmerten sich Planer und Wirtschaftsförderer weniger. Die Städte lichten sich wie Kopfhaar. In Bochum starb das Nokiawerk, Opel ringt um sein Leben. In den nächsten Jahren, heißt es, werden noch einmal gut 400 000 Menschen, mehr als Bochum Einwohner hat, das Ruhrgebiet verlassen. Ruhrgebietsuniversitäten werden immer voller - aber immer mehr Studenten, die fertig sind, wandern ab. Fast ein Drittel der Ruhrgebietsbewohner gehören zu Familien, die einst zum Arbeiten aus dem Ausland einwanderten. Die Hälfte der 15- bis 35-Jährigen mit Migrationshintergrund in NRW hat keine Ausbildung abgeschlossen. Wie jeder Ort hat das Ruhrgebiet Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Anders als anderswo spürt man hier, dass Zeiten nicht nahtlos ineinander übergehen. Gegenwärtige Leere wird mit Erinnerung aufgefüllt. Wo sich nichts Neues auftut, wird das Verschwindende festgehalten. Das ist anstrengend, aber nicht schlecht. „Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt“, sang Herbert Grönemeyer in den 80er Jahren über seine Heimatstadt Bochum. „Früher war's besser, was heißt das? Für mich zählt nur der Mensch, wie er sich gibt und wie er sich benimmt“, sagt Elli. „Wie du kommst gegangen, so wirst du empfangen.“
Vor Monaten betrat Grönemeyer ihren Laden. Es war kurz vor Heiligabend, er brauchte Geschenkpapier. 30 Jahre hatte Elli den Jungen nicht gesehen. Sie rief: „Du hast dich überhaupt nicht verändert!“ Jemand fotografierte. Das Bild hängt überm Zeitungsregal. Elli klemmt wie ein Plüschtier unter Grönemeyers Arm.
Sie wuchs am Rand von Bochum mit acht Geschwistern auf. Sie wurde Einzelhandelskauffrau, leitete mit 19 einen Edeka-Markt, war im Textilhandel, als die große Familie sie bat, im Tante-Emma-Laden für die schwangere Schwägerin einzuspringen. Sie half aus. Mit 29 übernahm sie das Geschäft. Das war vor 41 Jahren. Tante Emmas gibt es in Bochum nicht mehr. Es gibt nur noch Elli Altegoer. Die duzt die Kunden. „Das ist doch Zweck der Sache.“ Das große Geschäft ihres Lebens ist der Laden nicht. Und wiederum doch. Er ist das Leben schlechthin. Ein Zuhause.
Die Kunden sind mit Elli älter geworden. Den ganz Alten merkt man Montagmorgen an, dass ihnen das ganze Wochenende niemand zugehört hat. „Man kann reden und reden“, sagt Elli, „aber das Leben schreibt die Geschichten.“ Manchmal kann sie mit den Geschichten im Kopf zu Hause nicht einschlafen. Sie fährt Kunden zum Arzt, zum Frisör, geht für sie zur Apotheke, besorgt Balkonblumen, schleppt säckeweise Erde an, trägt ihnen Flaschenkisten treppauf. Derweil übernehmen die Kunden, die im Laden stehen, den Verkauf.
Der Kunde Jochen zum Beispiel. Trinkt Kaffee am Zeitungsregal und macht Zeitungen überflüssig, indem er über Gott und die Welt redet. Die Welt ist das Ruhrgebiet. Jochen ist Rentner, war Justitiar und Headhunter und einst als Ferienarbeiter unter Tage. Die vier Wochen nehmen viel Platz in seinen Erzählungen ein. Das Untertageruhrgebiet setzt sich an der Erdoberfläche fort. Jochen witzelt über Leute, die bröckelndes Deutsch sprechen, das klingt, als wären sie unablässig mit dem Presslufthammer zugange.
Der Kunde Roland lässt sich zum Kaffee ein Frühstücksbrötchen belegen. Er ist Orthopäde, war oft bei der Tour de France. Sein Leben hat sich durch die Dopingdebatte verändert. Mit Radsport lässt sich kein Geld mehr verdienen. In seiner Praxis gegenüber von Ellis Laden trägt er den Pullover von der Tour de Suisse. Mittags belegt Elli ihm wieder Brötchen. Nachmittags nimmt er nur einen Kaffee, und sie sagt: „Doktor, du brauchst was in den Bauch.“ 20 Minuten steht Roland jedes Mal wie festgeklebt, dann stürzt er aus dem Laden. „Leute, ich muss rüber!„
Nachmittags wandert eine Kanne Kaffee nach der anderen über den Stehtisch. Die Lehrerin von nebenan, die jeden Morgen das Obst für die Pause bei Elli kauft, schnorrt eine Zigarette. Ein Radiologe erinnert sich, wie schön Ärzte in den 70ern in der Bochumer Bergmannsheil-Klinik arbeiten konnten. „Wir sollten Unfallrente verhindern“, sagt er. „Wir hatten alles Geld der Welt zum Heilen.“ Der Kunde Udo, ein Mittfünfziger, wuchs in einem Haus auf, das der Vater gebaut hat: zwei Jahre lang, tagsüber, von dem Geld, das er nachts im Stollen verdiente. Alle Häuser ringsum waren so entstanden. In der Silvesternacht gingen die Nachbarn durch die Siedlung und reichten sich gegenseitig die Hand.
Nur wenn Gespräche politisch werden, hält Elli sich zurück. Ehrenfeld ist wohlhabend, hier wird CDU gewählt, Elli hat bei der Landtagswahl Anfang Mai für eine andere Partei gestimmt. Nun wird das große Nordrhein-Westfalen von einer Minderheitsregierung regiert. Das könnte klappen nach dem Prinzip, von dem Ellis Laden lebt: Vernünftig, bedacht und ausdauernd miteinander reden.
Kurz vor Ladenschluss kommt Armin Rohde auf der Harley. Er wollte mal in Berlin leben, ist dann doch in Bochum geblieben. Auch sein Vater war jahrelang unter Tage. Rohde hat ein Reihenhaus ausgebaut, im Saunabereich die Wand aufgestemmt und ein Loch gelassen, das aussieht, als ginge es in den Schacht. Neben das Loch hat er Kohlebrocken gelegt. Er steht auf Herkunft wie auf Ellis Zwiebelmettbrote, in die er große Bissstellen schlägt. Immer wieder will er bezahlen. Sie sagt: „Zu Hause zahlt man nicht.“
Vergangenes Jahr kam ein Brief in den Laden. „Sehr geehrte Steuernummer“, damit war Elli gemeint. „Uli, ich kann nicht mehr schlafen“, hat sie zu einem Kunden gesagt, ?Betriebsprüfung, warum denn das nach 40 Jahren?“ Finanzmann Uli erklärte, dass heutzutage Computer über Prüfungen entscheiden. Er nahm Elli in den Arm, versprach, dass nichts passiert. Obwohl er weiß, dass Kleinunternehmern schnell verheerende Buchhaltungsfehler unterlaufen. Dass ihr Glück oft vom Wohlmeinen der Beamten abhängt. Die Beamtin, die in den Laden kam, absolvierte die Prüfung, ohne etwas zu bemängeln. Eigentlich müsste Elli ihren Vornamen kennen. Vor lauter Aufregung hat sie sich nicht einmal den Nachnamen gemerkt.
Wenn Elli für den Laden Soll und Haben abrechnet, ergibt das eine einfache Gleichung: Sie hat gesucht und gefunden. Vor Jahren kam ein junger Mann, wusste nicht was er kaufen sollte und ob überhaupt. Sie goss Kaffee ein. Er war neu in Bochum, seine Ehe kriselte. Wer so traurig ist, ist gut, fand Elli, sagte: „Du wirst hier mal berühmt.“ Matthias Hartmann war der neue Intendant des Bochumer Schauspielhauses. Fortan konnte man bei Elli Theaterkarten bestellen. Hartmann handelte am Stehtisch im Laden Gagen aus, lud die Presse hierher ein und klemmte sich die kuschelige Elli immer wieder fürs Foto untern Arm. „Ehe du's aus der Zeitung erfährst, ich geh nach Wien“, sagte er nach fünf Jahren. Heimlich ist sie ihm nachgereist. Er hat sie zur Premiere im Foyer entdeckt, sich durch die Prominenz zu ihr durchgekämpft. Laut gesagt: „Das ist meine Elli!„
Dann fand Elli die 14-jährige Tochter eines Kunden. Das Scheidungskind tat ihr leid, sie gingen auf den Weihnachtsmarkt. Das Mädchen fragte: „Fährst du mit mir in den Urlaub?“ Viermal waren sie verreist. Elli stürzte sich ins Meer, stieg aufs Pferd, fühlte sich wie eine 30-jährige Mutter. Schließlich betrat der neue Schauspielhausintendant ihren Laden, streckte die Hand aus, nannte seinen Vornamen. Elli sagt: „Ich glaub, der wird hier auch was.“
Elli veranstaltet Sommerfeste, die Kunden machen Buletten, Salat, Kuchen und verkaufen. Der Erlös geht ans Hospiz um die Ecke. Das Geld vom Weihnachtsmarkt bekommt die Behindertenwerkstatt. „Nimm dir doch wenigstens ein bisschen was für die Vorbereitung“, sagt Jochen. Sie antwortet: ?Das ist doch dann kein guter Zweck mehr.“ Armin Rohde sagt: „Der Laden müsste als Kulturzentrum subventioniert werden.“
Mittwochs macht Elli schon mittags zu. Sie fährt mit dem Fahrrad durchs Ruhrtal, wandert, geht schwimmen. Manchmal mit einem Kunden, oft einsam. Oft will sie gar nicht zumachen. Sie fährt im Auto nach Hause und ist allein mit alldem, was sie in Gesprächen ihren Kunden nicht preisgibt. „Wenn sie meine Traurigkeit kennen, dann erzählen sie nichts mehr, weil sie denken, ich hab schon genug auszuhalten.“
Gewiss haben sie Elli gefragt, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger über sie herausbekommen. Sie sagt immer ungefähr so viel: „Der Mensch braucht Streicheleinheiten, ein bisschen Zuneigung.“ Sie hat ihren ersten Freund geheiratet, ein Kind ist dem Paar nie geboren worden, vielleicht hat das eine Bedeutung. Zumindest Doktor Roland scheint so viel zu ahnen, dass er Elli in den Arm nimmt sagt: „Hak ihn ab!“ Im Großmarkt steht sie vorm Regal mit Töpfen und Pfannen. ?Ich würde gern abends zu Hause gemeinsam kochen“, sagt sie. „Aber unter jedem Dach gibt's ein Ach.“ Im Auto im Zigarettenrauch fragt sie: „Was hab ich falsch gemacht im Leben?“ Zurück im Laden klingelt das Telefon. „Elliken, wie viel Milch habe ich neulich gekauft, reicht das noch?“ - „Reicht“, sagt Elli. „Elliken, kannst du kommen und mir die Augentropfen reinmachen?“ Sie fährt los.
Realität ist: Wenn Elli nicht mehr kann, wenn der Laden zu ist, kriegt sie ihn nicht mehr los. Sie wollte wissen, was er bringt, und hat eine Maklerin schätzen lassen. Die hatte sofort eine Idee: Alles wie's ist, nur italienischer. Mozzarella, Pasta, Ciabatta. Elli sagt, sie habe nichts gegen italienisch. Die Summe, die ihr genannt wurde, sei verblüffend hoch gewesen. Den Vertrag habe die Maklerin da gelassen, sagt Elli. „Ich sollte nur noch unterschreiben.“
Und dann sagt sie nichts mehr. Bewegt sich stumm in die Richtung, in die sich ihre Gedanken bewegen. Rückwärts. Bis sie an ein Lebensmittelregal stößt. Zurück in die Vergangenheit. Sie weint. „Mein Laden“, schluchzt sie. Sie kann nicht unterschreiben.
Nadja Klinger