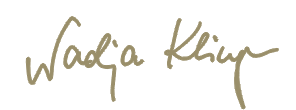Der Tagesspiegel, November 2008
Einmal im Monat, seit 18 Jahren, hält Gregor Böckermann Mahnwache vor der Zentrale der Deutschen Bank. Er will so lange damit weitermachen, „bis der Kapitalismus abgeschafft ist“. Nun scheint es so weit zu sein.
Der Kapitalismus kippt. Zumindest sieht es für Gregor Böckermann so aus. Wenn er die Baskenmütze festhält, den Kopf zurücklehnt und an der Fassade des Hochhauses der Deutschen Bank steil nach oben schaut, scheint es, als zögen nicht Wolken drüber hinweg, sondern als schwanke es. Als würde es jeden Moment auf die Männer und Frauen kippen, die vorm Eingang in der Großen Gallusstraße in der Frankfurter Innenstadt stehen, und sie unter Trümmern begraben. Ausgerechnet jene Menschen, die jeden ersten Donnerstag im Monat hier mit Transparenten vorm Kapitalismus warnen.
Als Gregor Böckermann die zweistündige Mahnwache zum ersten Mal anmeldete, fragte der Mann vom Ordnungsamt, wie oft sie stattfinden würde. Böckermann antwortete: „Bis der Kapitalismus abgeschafft ist.“ Das war vor 18 Jahren. In diesen Jahren hat Böckermann gelernt, das Herzklopfen zu ertragen, das ihn gängelt, wenn er sich entschließt, furchtlos zu sein. Er hat gelernt, ins Megafon zu sprechen, ohne mit der Stimme zu zittern, und trotz weicher Knie Rednerpulte zu erreichen. Er kann jetzt rasch über Zäune klettern. Er schämt sich nicht mehr, wenn Polizisten ihn wegtragen. Er stand vor Gericht, er saß im Gefängnis. Er ist 68 Jahre alt. Immer am Jahresende ruft ihn der Mann vom Ordnungsamt an und fragt: Geht's weiter? Böckermann bejaht. Der Mann vom Amt bittet drum, ihm das schriftlich zu geben. Sie wünschen sich frohe Weihnachten.
Anfang Oktober 2008, da der Bankrott einer amerikanischen Investmentbank den letzten Anstoß zur internationalen Finanzkrise gab, schien es, als hätte sich die Mahnwache bald erledigt. Jeder konnte nun im Fernsehen sehen, dass im Kapitalismus ein Systemfehler steckt. Dass Finanzunternehmen weltweit das Schicksal der Wirtschaft bestimmen. Dass ein Staat, der in der Krise gar nicht anders kann, als helfend einzugreifen, quasi Geisel der Banken ist. Böckermann fühlte sich wie ein Langstreckenläufer auf der Zielgeraden. Er sagte: „Jetzt sind wir überzeugt, dass der Kapitalismus noch zu unseren Lebzeiten überwunden sein wird.“
Voller Überzeugung stehen er und seine Mitstreiter am ersten Novemberdonnerstag wieder mahnend vor dem Bankgebäude. Böckermann trägt ein Plakat vorm Bauch: Unser Wirtschaftssystem geht über Leichen. Passanten bleiben stehen, fotografieren ihn mit Handys, gehen weiter. Bankangestellte, die Mittagspause machen, Wachmänner fotografieren auch. Es geht zu wie im Zoo. Böckermann ist eine seltsame Spezies, einer, der es ernst meint. Man gafft und bleibt auf Distanz.
Er wurde 1940 in Pommern geboren. Sein Vater war Bauer. Nach dem Krieg musste die Familie ihr Heimatdorf, das nun zu Polen gehörte, verlassen. Hunderte Kilometer westlich kam sie unter, in einem Schweinestall in Südoldenburg. Drei Jahre später schickte man sie weiter ins Emsland. Der älteste Sohn blieb zurück, um weiter die Mittelschule zu besuchen, den hohen Bildungsweg zu gehen. Gregor Böckermann bekam die Chance seines Lebens. Und er bekam Heimweh.
Heimweh, das war der Schmerz, den die Entfernung zum Zuhause bereitete. Er linderte ihn, indem er am Wochenende ins Emsland reiste. Aber er wurde ihn nie los. Sein Heimweh war chronisch. Es war die physische Begleiterscheinung seiner Suche nach einem Ort, an dem er sein konnte. Nach einem sinnvollen Leben.
Als er beschloss, ins Kloster zu ziehen, war er 20 Jahre alt. Er ging zu den Weißen Vätern, einem Orden von Afrikamissionaren, den es seit dem 19. Jahrhundert gibt. Er studierte in Trier Philosophie, wickelte in Belgien das Noviziat ab, reiste nach Rom, um Hocharabisch zu lernen. Ab 1968 lebte er als Entwicklungshelfer in Algerien, arbeitete in Bildungseinrichtungen, studierte Soziologie, promovierte, erwarb zudem ein Diplom in Islamwissenschaft. 1984 kam er nach Deutschland zurück, lebte mit Ordensbrüdern in einer Wohngemeinschaft in Frankfurt am Main.
Vor drei Jahren kehrte er ihr plötzlich den Rücken. Auch das hatte mit dem chronischen Heimweh zu tun. Der Orden war kein Ort mehr für Gregor Böckermann. Die Weißen Väter zahlten Rentenbeiträge nach, damit der hochgebildete Mann, der sein ganzes Leben der Mission gewidmet hatte und nun beim Staat Pension beantragte, wenigstens auf Sozialhilfeniveau leben konnte.
Er lebt jetzt in Neu-Isenburg bei Frankfurt in einer Siedlung mit Reihenhäusern, Garagen und winzigen Gärten. Hier zu sein fühlt sich an wie Feierabend.
Gregor Böckermann ist ein alter Mann. Die Farbe ist raus aus seinen Haaren. Einst war er groß und stattlich, jetzt droht sein hagerer Körper in dunklen Cordhosen und dunklem Rollkragenpullover zu verschwinden. Sein Gesicht wird schmaler, das merkt er daran, dass die silberne Brille immer größer wird. Vor vielen Jahren fürchtete sein jüngerer Bruder, der Bauer im Emsland ist, wegen des trockenen Wetters um die Kartoffelernte. Böckermann beruhigte ihn. Er sagte: Du wirst 1000 Zentner pro Hektar haben. Wenn das stimmt, erwiderte der Bruder, schenke ich dir einen Golf. Die Ernte betrug 1020 Zentner. Der Zettel mit der Abrechnung liegt in Böckermanns Bibel.
Wann willst du den Wagen haben?, fragte der Bruder. Böckermann antwortete: Mit einem Stück Land würdest du mir eine Freude machen. Auf dem halben Hektar, den er bekam, ließ er jeden aus der Familie - Eltern, drei Brüder, die Schwester, Schwägerinnen, Schwager, Nichten, Neffen - einen Baum pflanzen. Gregor Böckermann könnte sitzen und sich ausruhen: in seinem Wald auf Böckermannland, das grünt und blüht und Früchte trägt.
Stattdessen geht er mit Kirchenleuten, Schülern, Studenten durch Frankfurt am Main: durch Einkaufspassagen zum Edeljuwelier, bei dem Schmuck und Armbanduhren sechsstellige Preise haben. Zu Geschäften, deren Schaufensterdekoration mehr kostet, als Böckermann in sechs Jahren Pension bekommt. Er nennt die Touren Armenspaziergänge und bedankt sich bei denjenigen, die mit ihm gegangen sind. ?Weil ich über etwas reden durfte, das mir wichtig ist“, erklärt er. Er sagt: „Ohne den Kapitalismus zu kritisieren, kann man nicht Christ sein.“
Würde das Dasein eines jeden Menschen als Film in die Annalen der Weltgeschichte eingehen, begänne der Streifen über Böckermann mit der Szene, in der sein Vater mit glasigen Augen vorm Haus im Emsland steht und dem Sohn hinterherwinkt, der zu seiner Mission aufbricht. Es ist eine Abschiedsszene.
Ein starkes Land kann einem schwachen nicht helfen, indem es dieses Land von sich abhängig macht. Das hat Gregor Böckermann in Afrika begriffen. „Verändere Deutschland, um hier etwas zu verändern!“, sagten seine algerischen Freunde. In Frankfurt schloss er sich der Initiative Ordensleute für den Frieden an. Die IOF, in der längst nicht mehr nur Christen waren, war aus der Friedens bewegung hervorgegangen, hatte gegen Langstreckenraketen protestiert, hielt nun Mahnwache vor der Zentrale der Deutschen Bank. Auf ihren Transparenten standen Schlagworte des Protestes: Kapital und Krieg, Reichtum und Armut, globale Verselbstständigung der Finanzströme, Zinspolitik. Gregor Böckermann forderte Schuldenerlass für Algerien.
Im Adressverteiler der IOF sind rund 100 Leute. Etwa zwölf kommen zu Mahnwachen. Um aufzufallen, musste mehr veranstaltet werden. Da es gegen den Kapitalismus ging, war Böckermann für Aktionen zu haben, aber sie machten ihm zu schaffen.
Als er vorm Hochhaus auf dem Gehweg lag, weil die Banker „über Leichen gehen“ sollten, wäre er am liebsten gleich ganz im Boden versunken. Als sie 20 Liter Gülle vors Portal kippten, weil „Geld stinkt“, konnte er es einfach nicht ignorieren, dass dies auch eine riesengroße Sauerei war. Als sie sich festgekettet hatten, um die Einfahrten zur Bank zu versperren, dauerte es keine Viertelstunde, bis man sie mit Bolzenschneidern wieder losgemacht hatte. Böckermann aber fühlte sich, als käme er aus einem tagelangen Kampf.
Nach der Kettenaktion trugen Bankangestellte plötzlich Schnittchen und Kaffee ins Freie. Sie sagten: Ihr habt euern Trubel gehabt, jetzt können wir das Brot miteinander teilen. Die Aktivisten waren entsetzt. Nahmen nichts.
Das Widerstandsrecht eines jeden Bürgers ist im Grundgesetz verankert. Protestaktionen gehören zu unserer Gesellschaft, haben sich etabliert, sind so was wie eine Branche. Wo es ein Problem gibt, ist meist auch jemand, der dagegen protestiert. Es herrschen die Gesetze von Angebot und Nachfrage. Es waltet das Prinzip der Gewöhnung.
Wer vor der Deutschen Bank den Kapitalismus kritisiert, muss damit rechnen, dass der Vorstandsvorsitzende herauskommt, um die Hand zu reichen. So strahlte einst Hilmar Kopper in die Kameras der Pressefotografen und schwenkte freudig den Blindenstock, der ihm von der IOF überreicht worden war. Er schrieb Gregor Böckermann einen Brief und schickte Blumen, nachdem der sich im Gerangel mit einem Wachmann den Arm gebrochen hatte.
Anfangs hat die Kirche hinter Böckermann gestanden. Sie war sogar stolz auf ihn. Er saß zweimal im Gefängnis, weil er über einen Zaun geklettert war, eine Bannmeile verletzt und sich geweigert hatte, dafür Strafe zu zahlen. Doch irgendwann beschwerten sich Bankangestellte beim Bischof, weil der Ordensmann sich verbal mit ihnen angelegt hatte. Anfang 2005 petzte ein Kirchgänger, dass Böckermann in der Predigt Deutschland einen Unrechtsstaat genannt hatte. Er wurde zum Provinzial und zum Vizeprovinzial nach Köln bestellt. Er sagte: „Unsere Aktionen haben auch Zustimmung“ - im Jahr 2003 hatte die IOF „für ihr gewaltfreies, mutiges Eintreten für soziale Gerechtigkeit“ den Aachener Friedenspreis erhalten. Man erwiderte: Hitler hatte auch Zustimmung. Böckermann bekam Predigtverbot.
Bei seinem Abschied war Liebe im Spiel. Eigentlich hätte er sich zu dieser Liebe nicht bekannt, da er sich nun mal für den Orden entschieden hatte. Im Juni 2005 heiratete er, zog zu seiner Frau ins Reihenhaus.
Da die Hochhäuser der Deutsche-Bank- Zentrale an der Taunusanlage umgebaut werden, steht die IOF derzeit vorm Bankhaus in der Großen Gallusstraße. Zur Feier des Tages, weil Finanzkrise ist, sind Anfang November fast 20 Leute zur Mahnwache erschienen. Böckermann begrüßt sie durchs Megafon, als wäre das jetzt eine große Veranstaltung. Die Nacht zuvor hat er wieder schlecht geschlafen. Er will auf Passanten zugehen, anstatt sich für Fotos aufzustellen. Er ahnte, dass die Presse drum bitten und dass es ihm schwerfallen würde, unfreundlich zu sein.
Auch zum Landesvorsitzenden der niedersächsischen Linken, der am Tag zuvor bei ihm anrief, war er freundlich. Jetzt ist der Mann hier, hält sich schön in Pressenähe auf. Der Fraktionsvorsitzende von Hessen kommt auch noch dazu.
„Ihr hängt euch einfach an uns ran!“, beschimpft eine langjährige Mitstreiterin die Politiker. „Gregor, sind bei euch keine Linken gewollt?“, motzt der Niedersachse. „Wenn ein Politiker mich fragt, ob er kommen darf, nutzt er mich doch nicht aus, sondern ist von meiner Erlaubnis abhängig“, sagt Böckermann. Dem niedersächsischen Linken gefällt der ehemalige Ordensmann. „Etwas Demut würde Ihnen guttun“, sagt er zu der schimpfenden Frau. Dann verschwinden die Politiker. „Wie lange macht ihr noch?“, fragt der Hesse. „Zwei Stunden, wie immer bis zum Ende“, antwortet Gregor Böckermann. „Die haben andere Interessen“, sagt er zu den Aktivisten. Und murmelt in seinen Schal: „Die gehen Kaffee trinken.“
Nadja Klinger