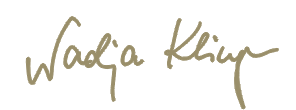Man lehrt ihn, laut und deutlich Danke zu sagen. Er will das Wort über die Zunge schieben, aber tief aus dem Innern, von jener Stelle her, wo die Erfahrungen gedreht und gewendet und ins Gebet genommen werden, empfängt er das Signal, sich zu verweigern. Denn zunächst ist der Mensch ja fast noch ein Tier. Angewiesen auf den wortlosen Dialog mit dem jahrtausendealten Instinkt für die Wirklichkeit. Alles, was dir ein Lebewesen zukommen lässt, warnt das tierische Gespür ihn jetzt, hat immer nur den einen eigennützigen Zweck, der nächsten Generation etwas von sich selbst unterzujubeln!
Folgsam setzt der kleine Mensch Zeichen der Dankbarkeit, ein Licht in seine Augen, ein Zucken an seinen Mund. Die das Drucksen übertönende Stimme sowie das Lachen bleiben aber lieber im Versteck.
Als ich so klein und derart verdruckst war, hieß es, ich sei eben ein schüchternes Kind. Es hatte einen Haken, mir dieses Adjektiv, diese, wenn auch akzeptierte, Schwäche anzuhängen, das habe ich bemerkt. Besser gesagt, habe ich etwas gewusst, worüber ich noch nichts wusste: dass meine tierische Schwachheit eine meiner ersten menschlichen Stärken war. Denn ich hatte schon Erfahrungen gemacht. Oft, nachdem meine Mutter mich geküsst hatte, spitzte sie ihren Mund, damit auch sie einen Kuss bekommt. Und wenn mein Vater beim Spazieren auf ein paar Meter Abstand zu mir ging, sich vorbeugte und die Arme weit öffnete, ich dann angerannt kam, er mich auffing und wie ein Kettenkarussell durch die Luft schleuderte, ging das meist länger als mir lieb war, während er mich einfach nicht loslassen wollte. Zum Geben gehörte also das Nehmen. Erfüllung fühlte sich deshalb so gut an, weil sie das Erwarten anfeuerte. Natürlich hatten diese meine Eindrücke vom Zusammenleben noch keinen festen Aggregatzustand und ich dafür weder das Sprechvermögen noch Worte. Doch sie waren etwas, worauf ich, ohne es genau zu wissen, reagierte. Zumindest zu Beginn.
Später dann. Spricht der kleine Mensch so gut, dass mit dem Auftauchen eines Geschenks sofort das Gesetz des laut-und-deutlich-Bedankens greift, und er hält sich dran. Allerdings klingt, was aus seinem Mund kommt, wie Schluckauf, als bocke sein Zwerchfell, als würde es die Stimmritze verschließen und die Atemluft abprallen, ihn nicht funktionieren lassen. Hicks! Jemand beugt sich zu ihm runter und legt die Hand ans Ohr: „Wie bitte? Ich habe nicht verstanden.“ Aber der kleine Mensch versteht ja auch nicht! Was ist denn da gerade passiert? Er hat doch nur genommen, was man ihm gab, etwas hat lediglich die Hände gewechselt! Trotzdem spürt er das Geschenk im ganzen Körper, mit Wucht, so als wäre derjenige, der es übergab, währenddessen bei ihm eingedrungen! Hicks!
Wer jemanden beschenkt, muss nicht einmal leibhaftig anwesend sein und ist doch immer vor Ort. Atmet, ohne Sauerstoff zu verbrauchen, bewegt sich, ohne Luft zu verschieben. Geht um. Das Geschenk gehört jetzt dir, aber der Schenkende ist der Geist dieser Gabe. Ein guter oder ein böser, je nachdem, ein mächtiger jedenfalls, weil er mit Aufmerksamkeit bestochen, einen Wunsch erfüllt, einen Wert realisiert, weil er die Möglichkeit genutzt hat, eine neue Wirklichkeit herzustellen. Ob sie es will oder nicht, geht die Person, die er beschenkt, eine soziale Beziehung mit ihm ein.
Gehe ich zu weit, wenn ich behaupte, dass der kleine Mensch, der sich zwar schon bedanken, aber ein Geschenk nicht ablehnen kann, das sich prompt seines Körpers bemächtigt, wo jetzt pure Freude, anerzogene Scham und gesunde Beklommenheit wie Brauseperlen sprudeln, spürt, dass an ihm gehandelt wird? Hicks! Es sind die Geschenke, diese unerklärlichen Momentaufnahmen unentgeltlicher und kalkulierter Zuwendungen, die uns beizeiten ermahnen zu misstrauen.
Auch an die Zeit dieses grotesken, zugleich ernsthaften Schluckaufs erinnere ich mich. An Heiligabende mit Gaben unterm Weihnachtsbaum, an denen ich, um dem Hicksen zu entkommen, meinen Eltern stumm in die Arme fiel. An das jäh veränderte Sein nach dem Auspacken, in dem jeder Wunsch erfüllt, aber keine Sehnsucht mehr vorhanden, wo die gedämpften Gespräche meiner Eltern sich garantiert nicht mehr um mich drehten, unsere Familie nicht mehr dieselbe war.
Misstrauen hin oder her, schon bald gehen wir – nun sind wir erwachsen und mit dem „Danke!“ klappt es prima – dazu über, uns für Geschenktes sogar erkenntlich zu zeigen. Auf welche Weise auch immer wir das anstellen, ob wir ebenfalls etwas geben, ob es sich dabei um ein teures Ding handelt, eine gute Tat oder schöne Worte, ob wir vielleicht auch einfach nur anwesend, pünktlich, attraktiv, treu sind – es passiert: Wir tun etwas, das wir sonst nicht getan hätten. Lassen uns auf die neue Wirklichkeit ein. Wollen sie sogar haben, nicht selten, sondern oft und immer wieder. Wollen die Bindungen ausbauen, wenn sich das so ergibt, zusammenleben anstatt allein.
Wir nehmen und geben, bescheren, bieten dar, opfern. Wir überraschen, weil andauerndes gefasst bleiben der Stillstand wäre. Während der Zeit, in der wir uns damit beschäftigen, was wir einem Menschen schenken könnten, geht es uns gut, denn wir nähern uns ihm gerade an. Unser Geben nimmt Einfluss, ist gar mächtiger als das Nehmen. Und dass wir von uns selbst glauben, im Gegenzug nichts zu erwarten, ist unsere allerschönste Illusion.
Schon bevor wir geboren wurden, hatte das Schenken Tradition. Viele unserer kalendarischen Feste kommen heutzutage ohne althergebrachte Riten, aber nicht ohne Geschenke aus. Unsere kriegerisch anmutenden Eroberungen in von Geschäften besetzten Innenstädten im Dezember nimmt sich zuweilen wie eine Entwürdigung des seligen Weihnachtsfestes aus. Klar, machen wir uns darüber Gedanken. Wollen nicht „irgendwas“ verschenken. Kommen auf Ideen. Malen, schreiben etwas auf, stricken, bauen, kreieren, basteln. Wir misstrauen den Geschenken gewissermaßen immer noch. Mitunter sehr. Erfinden und pflegen dann die Wir-schenken-uns-dieses-Jahr-nichts-Rituale. Feiern das kurze Innehalten im Lauf der Dinge. Unseren Eigenwillen. Aber warum fühlt sich ein Weihnachten ohne Schenken so gut an? Nur deshalb, weil es gewissermaßen für alle, die sich daran beteiligen, ja auch ein Geschenk ist.
Unser erstes Geschenk war unsere Geburt. Das Herz hat geschlagen, die Lunge hat funktioniert, eines Tages haben wir uns aufgesetzt, dann gestanden, dann sind wir losgelaufen, um zu geben und zu nehmen. Was wir nahezu alltäglich füreinander bereithalten und annehmen kostet kein Geld. Keine Verkaufsstelle bietet es an, dennoch hat es einen Wert und, wenn man so will, sogar einen Preis, der aber nicht mit einer Währung, sondern mit einer ganz anderen Art von Aufwand beglichen wird.
Jeder von uns hat sich selbst schon verschenkt. An den einzigen Ort unserer Wirklichkeit, den wir auf diese Weise selbst errichtet haben, für den nur wir die Schlüssel besitzen und an dem wir uns, sobald wir die Tür hinter uns geschlossen haben, so sicher sein können wie nirgends sonst. Da wo unsere Freundschaften wohnen, reißen wir uns beherzt auf, geben uns ohne Zögern hin. Da, wo wir unser Vertrauen hergeben, schenkt man uns welches, und wir lassen uns ein: auf Zeit, die wir nicht messen, auf Teilnahme, die kein Maß kennt, auf Fragen, die uns zu etwas herausfordern, das wir uns bislang nicht zugetraut haben; auf unser Spiegelbild, dem wir sonst zu entkommen versuchen, auf die Gefahr zu verletzen und verletzt zu werden, da sie einherkommt mit der Möglichkeit, Versöhnung zustande zu kriegen und Trost zu finden.
Und wenn wir noch tiefer als kameradschaftlich lieben, gehen wir über das, was wir für unsere Freundschaften tun, über die emotionalen Bannlinien, die wir für unsere ultimativen persönlichen Grenzen hielten, noch hinaus. Unsere familiären Liebesbeziehungen sind leere Zimmer, in denen wir beständig miteinander in Austausch treten, ausgestattet mit, nennen wir es Mobiliar, das immer wieder wechselt – abhängig von der tagtäglichen, also unzuverlässigen Bereitschaft, sich zu verschenken. Da all diese Zimmer zu der Wohnung gehören, in der wir uns zusammen mit jemand anderem von der Außenwelt abgrenzen, ist unsere prekäre gegenseitige Hingabe und Hinnahme aller Lebensraum, den die Liebe hat. Das Vernachlässigen jener Gepflogenheit, einander mit immateriellen Gaben zu überhäufen, macht ihn ungemütlich. Gibt es kaum noch derartige Geschenke oder gar keine, existiert er nicht mehr.
Wir schenken einander: jauchzende Faszination, die plötzlich vom siebten Himmel heruntergeschwebt kam, zu gewichtiger Bewunderung verwertet und immer wieder nachgebildet werden muss; Versprechen, unverpackt; Interesse mit Schleifenband, fester Knoten; Sonderrechte, die wir nutzen, aber nicht ausnutzen; Sorge und Fürsorge, auf die wir uns verlassen und die wir ebenso stark fürchten, weil sie uns ans Ende unserer Kräfte bringen könnte, über das wir dann auch noch unbedingt hinauswollten. Wir schenken einander Vertrauen von genau dem Umfang, den wir uns selbst wünschen. Zeit, in einem Ausmaß, das zum Höchstmaß werden, weil ein ganzes Leben bemessen könnte.
Wir sehen die Liebe als das allergrößte Geschenk an. Obwohl sie der Zustand ist, der uns dazu bringt, uns mit dem Schenken zu verausgaben. Obwohl wir, wenn wir lieben, nicht selten hinnehmen müssen, dass auch hier nicht alles so ist, wie wir es uns wünschen. Vielleicht zelebrieren wir deshalb immer wieder – im Verlauf eines jeden Jahres mit seinen offiziellen Fest- und Feiertagen, in strenger, kalendarisch festgelegter Regelmäßigkeit – die Verbindung von Wünschen und Beschenken.
Vielleicht haben wir wirklich keine Wahl. Geben, wenn besagte Tage anstehen, Geld aus, das wir aus Selbstschutz eigentlich festhalten müssten, weil wir uns vor allem eins nicht leisten können: am Schenken und beschenkt werden zu zweifeln.
Vielleicht wäre der Zweifel aber auch eine schöne – die Vokabel jedenfalls passt trefflich – Gabe? Denn das segensreiche Schenken ist heutzutage auch teuflisch. Beispielsweise, wenn wir alles mitnehmen, was man einfach so haben kann. Wenn wir dafür dann das schwache Verb „geschenkt“ missbrauchen und es obendrein mit dem Adverb der absoluten Vergeblichkeit besudeln: „umsonst“. Wenn wir uns gleichmachen mit all den anderen, die ebenfalls zugreifen, dafür das beste wegschmeißen, was jeder von uns schon besitzt: ganz individuell zu sein.
Wenn die beiden Tüten Gemüsebrühe von der Die-zweite-zum-halben-Preis-Banderole zusammengehalten werden, haben wir nichts geschenkt bekommen, sondern mehr gekauft, als wir haben wollten. Wenn wegen des Abo-Geschenks heute eine Zeitschrift in unserem Briefkasten steckt, haben wir gestern jemanden an unserer Großhirnrinde herumfummeln lassen. Wenn der Voucher, der zur Zimmerbuchung dazugehört, kostenlose Getränke offeriert, wird abends an der Hotelbar nicht beschert, sondern gedealt.
Einst, am Tag unserer Geburt, nachdem unsere Mütter uns das Leben geschenkt hatten, haben wir uns nicht bedankt. Kein Neugeborenes hat das je getan. In unserer Entwicklungsgeschichte steht davon nichts geschrieben, unser Bauplan sieht das nicht vor, die physikalischen und biochemischen Vorgänge in unseren Körpern sind auf sowas nicht ausgerichtet. Der Dank kommt nicht aus der Biologie, sondern erst in Gesellschaft. Hält sich bereit, in der weiträumigen Landschaft der Geschenke. Geben und Nehmen sind ihm gleich nah. Er ist unsere erlesenste Möglichkeit. Danke!
Nadja Klinger