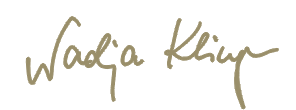Kopieren und einfügen. Obwohl ich begreife, dass die tägliche Frage Wie geht’s? selten so ernst gemeint gewesen ist wie jetzt.
Anfang März war ich für ein paar Tage wieder in Berlin. In meiner verschwenderischen Heimatstadt wurde heißblütig gehamstert, und einige Hamster waren gute Freunde von mir. Irgendwas stand an, keiner konnte genau sagen, was. Auch in meiner WG geriet das Virus ständig in die Gespräche … wir wussten noch wenig darüber. Wir versprachen einander, nicht mehr drüber zu reden, und wenn doch, dann sachlich. Dabei ging es eigentlich schon jetzt um unsere Befürchtungen, um Angst.
Als Donald Trump in Washington seine Rede an die Nation hielt, habe ich geschlafen. Anders gesagt, mein Telefon war im Flugmodus, als K. anrief und die Nachricht hinterließ, dass ich binnen 48 Stunden in New York landen müsste, um noch in die USA gelassen zu werden. Die Fluggesellschaft hatte Trump nicht verschlafen; am Morgen waren die Ticketpreise um ein Vielfaches gestiegen; ich konnte nur deshalb noch nach Hause, weil K. in New York über den amerikanischen Server noch einen billigeren Flug erstehen konnte.
Freitag, der 13., morgens um fünf. Ich stand in einer der Schlangen, die die Gänge des Flughafen Tegel blockierten wie ein mit Männern, Frauen, Kindern und Koffern verstopfter Darm. Soll ich im Bild bleiben? Durch die von Maskierten und Behandschuhten grimmig bewachten Einreiseschleusen am Flughafen Newark, wo ich oft Stunden gewartet hatte, hat man uns flutschen lassen wie Durchfall. Etwas Ekelhaftes. Nur der Mann, der mein Visum ansah, fragte, warum mein Ausflug nach Berlin so kurz gewesen sei. Ich sagte: „Sie wissen doch, warum“, und er: „Ich entschuldige mich für diesen verrückten alten Mann.“
Am Tag meiner Heimkehr hat mich die beigefarbene Corona-Landkarte der USA (Where cases have been reported), die die New York Times täglich veröffentlicht, noch an einen Schnappschuss vom Körper eines von Windpocken befallenen Kindes erinnert, das sich an einigen Stellen, rechts oben, links oben, links in der Mitte, wundgekratzt hat. Ende März war nicht nur das Bild ein ganz anderes, ganz anders war auch das, was es in mir auslöste; jetzt zogen die roten Punkte in Fronten, stellenweise zu dunkelroten Armeen vereint, über die Neue Welt wie Eroberer: von der Atlantikküste, wo vor 400 Jahren die Mayflower geankert hat, Richtung Pazifik, wo Seattle, San Francisco und Los Angeles den Virus eben in den Griff zu bekommen schienen. Und ganz offensichtlich fehlten Chief Joseph, Sitting Bull, Spotted Elk oder Crazy Horse. Es fehlten die, die die Armee der Punkte auch nur ein einziges Mal hätten aufhalten können.
Zu Hause in Bushwick: Mein Postfach war voll. Jeder Coffee Shop, jede Bar, jeder kleine Laden, der je von meiner Kreditkarte abgebucht hatte, verabschiedete sich von mir. Und alle baten um Hilfe. Das heißt um Geld. „Ich habe immer gewusst: Wenn eines Tages das Ende käme, würden die New Yorker ihm von einer Bar aus entgegensehen“, schrieb ein Reporter der New York Times, „aber dies ist nicht das Ende, das sich auch nur ein einziger von uns hat vorstellen können.“ Die Metropolitan Opera, die New Yorker Philharmoniker, das Metropolitan Museum, das New York City Ballett, all die Menschen, die in den Theatern am Broadway ihren Lebensunterhalt verdienen, waren da auch schon in Schwierigkeiten, was ich hier anfüge, weil man bei Erschütterungen geneigt ist, sich irgendwie zu sichern, sich etwas Festes zu suchen – zum Beispiel Theater, Ballett, Museen, Musik. Es gibt aber gerade kaum noch Unerschütterliches in New York.
Am nächsten Morgen fuhr K. nach Manhattan; zum letzten Mal. Der asiatischstämmige Schneider in Chelsea hatte seine Hosen repariert. „Und? Wie geht’s Ihnen? Morgen müssen Sie doch zu machen?“ - „WAS?“ - „Na, wie vom Bürgermeister angeordnet. Alle müssen zumachen.“ - „Wo haben Sie denn das her?“ - „Aus der Zeitung natürlich.“ - „Oh … vielen Dank.“
Während die beiden dieses Gespräch geführt haben, bin ich gejoggt. Wie immer nach einem Langstreckenflug taten meine Knie weh, aber mich hat nur mein Atem interessiert; ich klang gut. Bushwick dagegen schlecht. Es gab noch keine Ausgangsbeschränkungen, überall waren Menschen unterwegs, nur anders, es fehlten: der schwerwiegende Leichtsinn, die harmonische Unregelmäßigkeit, die schluderige Gesinnung. Bushwick hatte seinen Puls verloren.
Genauso die alte Glasfabrik, in der wir wohnen. Bis auf den Waschkeller und einen Raum, in dem täglich massenhaft Onlinebestellungen und Essenlieferungen anlanden, waren alle öffentlichen Orte abgesperrt: Bibliothek, Lounge, Arbeitsräume, Garten, Dach. Kavien und Kieran, die beiden Hausmeister, die mir in rollendem, zischenden Spanisch-Englisch Erstaunliches über Geschirrspüler, Gasherde, Klimaanlagen, Kippfenster, Toilettenpapierhalter, Schlösser und Türklinken beigebracht hatten, kamen nicht mehr; das ganze Haus gab kaum noch ein menschengemachtes Geräusch von sich. Der Abfallraum sah aus, als hätte New York kein Müllproblem.
Nur die hauseigene WhatsApp-Gruppe gab Lebenszeichen. Etliche unserer Nachbarn hatten ihre Jobs verloren. Die Miete konnten sie schon jetzt nicht mehr zahlen. Das Problem hat die ganze Stadt, das ganze Land: Annähernd die Hälfte der Amerikaner, habe ich gelesen, haben weniger als 400 Dollar auf dem Konto. Den New Yorkern hat man gesagt, die Zeit nach Corona werde noch schwerer als die nach 9/11; die USA rechnen landesweit mit mehr Arbeitslosen als nach der Großen Depression. Ich habe die WhatsApp-Gruppe verlassen. Ich habe mich dort falsch gefühlt. Fremd. Wie ein Zuschauer. Oder ich habe, mag sein, die Sorgen meiner Nachbarn einfach nicht ausgehalten. Ich kenne solche Sorgen nicht, sie machen mich völlig hilflos, bringen mich um die letzte Ruhe.
Vielleicht sollte ich an dieser Stelle sagen: Mir geht es gut.
Das Hausmanagement hat unseren Nachbarn den Wunsch, die Mietzahlung auszusetzen, abgeschlagen. Wenn einer von uns sich mit dem Virus infiziert, soll er sich melden. Dann werden Kavien und Kieran geschickt, um zu putzen. Hinter manchen Türen hört man jemanden husten.
Was ich ansonsten höre: Vögel. Ich wusste gar nicht, dass es hier welche gibt. Jetzt flattern sie von allen Seiten herbei, jagen sich, tanzen umeinander, prahlen mit Sturzflügen, gucken in Schornsteine. Dicke Möwen mit Hitchcock-Schnäbeln kommen vom Meer bis auf unsere Terrasse.
Als New York Ausgangsregelungen verpasst wurden, habe ich etwas gelernt, worum ich mich als Stadtkind immer gedrückt hatte: Menschen machen Krach. Ihre Gespräche machen Krach, ihre Gesänge, ihre Bewegungen. Liebende machen Krach, wenn sie aus vollem Herzen lachen, aus vollem Herzen streiten. Autotüren machen Krach, Motoren, die nicht abgestellt werden, während der Pizzabote liefert, Klingeln und Sprechanlagen und Straßenhändler und Imbissbesitzer, die das Mobiliar auf dem Gehweg zurechtschieben, machen Krach.
Am 18. März haben wir auf dem Telefon die Fernsehansprache der Bundeskanzlerin gesehen. „Anderthalb Meter, besser zwei.“ Eine Empfehlung. Bei uns hier empfiehlt man: six feet, und das ist, wie man weiß, ausgerechnet das Maß, in dem ein toter Amerikaner unter die Erde kommt.
Nachts im Bett vermisse ich: das Hämmern der Bässe in den SUVs, das Aufjaulen der Motorräder, das schabende Geräusch eines Skaters, der in den Morgenstunden auf dem Heimweg ist. Ich vermisse das Wispern auf den Feuertreppen und die energiegeladenen Stimmen unserer hispanischen Nachbarn, die sich immer erst spätnachts in ihre kleinen Wohnungen zurückziehen. Ich vermisse die Hip-Hop-artig geführten Gespräche der Schwarzen unter meinem Fenster.
Ich richte mich im Bett auf, um die Skyline zu sehen. In einer deutschen Zeitschrift stand: Die Wolkenkratzer von Manhattan sind dunkel. Das stimmt nicht. Die Insel leuchtet am Abend so bunt wie sonst auch. Wie eh und je hat das Empire State Building regelmäßig seine Farben gewechselt, bis es vor ein paar Tagen plötzlich knallrot dastand und immer zur vollen Stunde mit der weißen Spitze im Rhythmus eines Herzschlags blinkte, was mich unweigerlich an die Rettungswagen der Krankenhäuser und der Feuerwehr denken ließ, die zum dominierenden Stadtgeräusch geworden sind. „Wir leuchten in Solidarität mit Millionen Menschen in 180 Ländern, die von COVID-19 betroffen sind“, hat das ESB später auf Twitter mitgeteilt. „Wir zollen zu jeder vollen Stunde allen Ersthelfern unseren Respekt.“ Nur abends um neun erstarrt das Gebäude fünf Minuten lang in Dunkelheit „im Gedenken an alle Kranken, die ihr Leben gelassen haben“.
Nicht lange nachdem ich aus Berlin weg war, ist New York City zum Zentrum der Epidemie in den USA geworden. Achteinhalb Millionen Menschen, kaum Krankenhausbetten, so gut wie keine Beatmungsgeräte. Wie viele der unzähligen Amerikaner ohne Krankenversicherung überhaupt um ärztliche Hilfe ersuchen, weiß ich nicht. Ihr fragt: War die Rückkehr nach New York die richtige Entscheidung?
Jeden Tag fotografiere ich jetzt den Himmel. Er ist so, wie er immer war.
Jeden Abend gehen K. und ich raus, spazieren. Links, Richtung Süden, kommen wir in unsere hispanische Nachbarschaft; es sind weniger Menschen als sonst auf der Straße, aber immer noch viele; sie stehen in Gruppen und reden; wer da hindurchgeht, zerreißt sozusagen ihre virenpotenten Gesprächsfäden. Bis vor wenigen Tagen war der Maria-Hernandez-Park noch voll. Im Hundeareal standen Herrchen und Frauchen alle in einer Ecke. Kiffer dösten dicht an dicht auf den Bänken, es wurde Volleyball und Basketball gespielt. Geskatet. Erst seitdem der Gouverneur die jungen Leute Anfang April streng ermahnt hat, wird es leerer am Hernandez-Platz.
Eigentlich lieben wir diese Gegend, kaufen gern dort ein, in winzigen Läden mit frischem Angebot. Aber auch dort drängen sich noch immer Mensch an Mensch: alles Leute, deren Zuhause kaum mehr Platz bietet, als eine Familie zum Schlafen benötigt. Im Sommer drehen die Väter die Hydranten in den Straßen auf und spielen unterm Wasserstrahl Domino; wenn die Keller überschwemmt sind, kommt die Feuerwehr, wenn sie weg ist, drehen die Mütter die Hydranten wieder auf. Kann sein, dass sie von social distance hier schon gehört haben; dass sie sogar wissen, dass Familien derzeit unter sich bleiben sollen. Aber die Straßen sind nun mal ihre Wohnzimmer.
Also gehen wir jetzt nur noch nach rechts. Kommen ins polnische Viertel am Rand von Queens, wo Reihenhäuser stehen und ein gewisser Wohlstand sich abzeichnet, man gebildeter ist, jedenfalls innerlich ausgeruht; dort sitzt man hinter schmiedeeisernen Zäunen auf Vortreppen unter der amerikanischen Flagge. Was ein Fremder im Kopf hat, wenn er „New York City“ sagt, findet sich in dieser Gegend nicht, aber nur wo man einander ausweicht, wird die Stadt überleben.
Nicht ausweichen kann ich dem, was die Nachrichten bringen: Noch immer befinden sich die USA auf dem Weg zum Wellenkamm der Erkrankungen. Es gibt jetzt auch eine Windpockenkarte von New York. Ende März hatte die Stadt 44 000 Infizierte, zu Ostern 200 000, das sind 70 000 mehr Kranke als in ganz Deutschland.
Die Gegend mit den meisten Infizierten in New York heißt übrigens ausgerechnet Corona. Hieß schon immer so. Liegt in Queens.
Vor ein paar Tagen sagte K., der so gut wie alles liest: „Wir brauchen einen Plan für den Fall, dass wir schnell wegmüssen!“ Er sprach von Läden, denen die Grundnahrungsmittel ausgehen, davon, dass es in der Nachbarschaft ungemütlich werden könnte, vom unfassbaren Anstieg der Waffenverkäufe in den letzten Wochen. Wir haben unseren Coronaplan gemacht – kaum einvernehmlich, sondern mit der Wut, die entsteht, wenn garstige Not und friedliche Verständigung miteinander auszukommen versuchen. Nachts habe ich geträumt: Hinter mir lag mein Zuhause, vor mir meine Heimatstadt, ich war im Laufschritt unterwegs, und beides – das, wo ich hinlief, und das, was ich zurückgelassen hatte – entfernten sich immer schneller immer weiter von mir.
Nun gut. Morgens joggte ich wieder. Durch 11237 Bushwick, Brooklyn, New York, wie immer. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, liegt die New York Times, gewickelt in eine blaue Plastiktüte, auf dem Gehweg vorm Haus. Die Zeitung hat ihren Lesern mitgeteilt, dass die erste Person, die das Blatt in der Druckerei anfasse, Wegwerfhandschuhe trage und dieselbe Person sei, die es auch liefere. Ich verstehe nicht, wie das gehen soll, aber ich will es glauben.
Vor vier Tagen habe ich beim Joggen einen anderen Weg genommen, vorbei am Wyckoff Heights Medical Center, das unweit von unserem Haus steht und tagein tagaus von jaulenden, trötenden Rettungswagen angefahren wird. Am Seiteneingang wurde gerade ein riesiger weißer Kühlcontainer aufgestellt und so mit weißer Plane umspannt, dass der Weg zwischen Container und Krankenhausausgang nicht einzusehen war. Ich kannte diese Container schon von Fotos aus Manhattan. Auch bei uns sterben jetzt so viele Menschen, dass im Krankenhaus kein Platz für die Leichen mehr ist.
Vor Tagen: ein zweiter Container.
Dann: der dritte, der vierte.
Im Vierten sah ich zwei Männer stehen. Sie haben Regale eingebaut.
Über 180 000 Ärzte, Schwestern, Pfleger sind aus dem ganzen Land mit Atemgeräten nach New York gekommen, um zu helfen – und wenn die Windpocken auf der USA-Coronakarte bald die anderen Städte erreichen, ziehen sie mit ihren Geräten und mit den New Yorker Medizinern weiter. Ich sehe, wie sie, von oben bis unten in blaues Plastik verpackt, in den stillen Straßen rund ums Krankenhaus auf Bordsteinen, Zaunsockeln, Treppenstufen sitzen, jeder für sich, starren sie einfach vor sich hin, manche rauchen. Noch nie habe ich so dermaßen erschöpfte Mitmenschen gesehen. Ich würde gern bei ihnen stehenbleiben und mit ihnen reden. Aber ich darf nicht. „Bleiben Sie gesund!“, habe ich anfangs im Vorbeigehen gesagt. Dabei sahen sie alles andere als gesund aus. Mittlerweile sage ich: „Gott schütze Sie!“
Andere Bilder, die zu vergessen nicht gelingt: Drohnenaufnahmen von Hart Island, der kleinen, unbewohnten, zur Bronx gehörenden Insel im Long Island Sound, wo 1868 der riesige Armenfriedhof Potters’s Field errichtet wurde und die Stadt im 20. Jahrhundert ihre Opfer der Spanischen Grippe und der AIDS-Krise begraben hat. Man sieht einen riesigen dunkelbraunen Sandgraben, in dem in Weiß verpackte Menschen schlichte Holzkisten so versenken, dass, dicht an dicht, Stapel entstehen – so wie sie in einem Keller vorgehen würden, der für all das, was sie zu lagern haben, viel zu klein ist.
Noch mehr Bilder. In vielen Vorgärten unserer Nachbarschaft stehen mittlerweile Totenkerzen. Blumen liegen daneben oder es hängt ein Kleid oder eine Jacke auf einem Bügel am Zaun. Hin und wieder fällt das schwache Licht auf ein Dominospiel.
Was für eine Zeit.
Manchmal, unwillkürlich, in Momenten von Unklarheit und Furcht, geht mir durch den Kopf, dass ich versuchen müsste, auch etwas dankbar zu sein für das, was diese Zeit in mir auslöst. Und ehe ich mir die Dankbarkeit wieder verbiete, denke ich noch schnell, dass in den Köpfen anderer Menschen dasselbe geschehen möge. Dass wir unser Leben noch einmal vollkommen anders sehen. Wahrscheinlich ist das kitschig. So kitschig und real wie die Skyline von New York. Was ich vergessen habe zu erwähnen: Es fliegen kaum noch Flugzeuge über der Stadt, aber sobald es dunkelt, steht, wenn ich von unserer Glasfabrik zum One World Trade Center schaue, ein Flugobjekt in der Luft; zu leise für einen Hubschrauber, zu groß für eine Drohne. Es guckt uns alle an. Auch der Himmel ist nicht mehr das, was er mal war.
Liebe Grüße!
Nadja Klinger